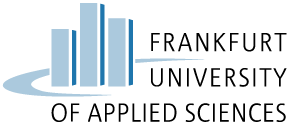- Dozent/in: SchirockyRalf
campUAS
搜索结果: 6665
Internes Rechnungswesen als Teil des betrieblichen Rechungswesens.
Die Kosten- und Leistungs-Rechnung als Herzstück des interen Rechnungswesens.
- Dozent/in: SchirockyRalf
Interens Rechnungswesen (IRM) als Teil des betrieblichen Rechnungswesen.
Die Kosten-und Erlös-Rechnung als Herzstück des IRW

- Dozent/in: SchleglerMaren
Schlögl, Vejnik : IP [S]LOTS Mobilitätsräume in Großsiedlungen entdecken und verwandeln - WiSe 23/24

Thema
In Metropolregionen wie Paris, Wien oder dem Rhein-Main-Gebiet ist das Parken ein viel diskutiertes Thema der Stadtplanung. Laut Umweltbundesamt wird ein Auto im Durchschnitt eine Stunde pro Tag bewegt. Die restliche Zeit nimmt es in Städten einen beträchtlichen Teil des öffentlichen Raums in Anspruch. Auch auf den Parkdecks neben Wohnhochhäusern oder in autogerecht geplanten Siedlungen stellt sich - mit Blick auf die Verkehrswende - die Frage nach einer Neuprogrammierung der ursprünglich für den ruhenden motorisierten Individualverkehr versiegelten Flächen.
Lehrmethode
Ausgehend von der gemeinsamen Analyse exemplarischer Parkhausarchitekturen und Erschließungsflächen in Großsiedlungen im Rhein-Main-Gebiet widmet sich das Lehrforschungsprojekt zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten dieser weitverbreiteten Infrastrukturen. Begleitet von Feldforschungsphasen, Archivbesuchen, Interviews und theoretischen Reflexionen wird in exemplarischen Entwürfen die Wandlungsfähigkeit verschiedener Parkraum-Typologien ausgelotet.
Welche Funktion(en) können Flächen zum Parken – geplant für Großsiedlungen und ausgerichtet auf den motorisierten Individualverkehr – in Zukunft erfüllen?
Wem gehören die versiegelten Flächen und wie werden sie verwaltet?
Wie wirkt sich der Wandel im Mobilitätsverhalten und der damit verbundene Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs auf die Nutzung von Parkplätzen in der Nähe von Wohnanlagen aus?
Welche Aktivitäten finden auf Parkdecks, in Kleingaragen und entlang von Zufahrtsstraßen, abgesehen vom Abstellen des privaten PKW, statt?
Literatur
BCN 532, Raum 1-626 oder ONLINE
Raum 1-626
Phasen
1 / Mitte
Oktober bis Ende Oktober
Luftbildrecherche im Rhein-Main-Gebiet
2 / Ende Oktober
bis Mitte November
Feldforschung auf Basis der Luftbildanalyse zu ausgewählten
Parkplatzinfrastrukturen
3 / Mitte
November bis Anfang Dezember
Vertiefung der Analyse und Entwicklung erster Entwurfsideen
4 / Anfang
Dezember bis Ende Jänner
Ausarbeitungsphase und Workshops
Abschlusspräsentation und Abgabe
Aufgaben
UE1 /
SUCHEN (Einzelarbeit)
Wir
begeben uns auf die Suche nach Parkplatzinfrastrukturen in der unmittelbaren
Umgebung von Großsiedlungen in ausgewählten Regionen innerhalb des
Rhein-Main-Gebiets. Am
27. Oktober: Mitnahme von zehn möglichst unterschiedlichen Fundstücken in Form
von Luftbildaufnahmen. Zur besseren Vergleichbarkeit gibt es ein Manual auf campUAS.
Aus den mitgebrachten Ausschnitten und Daten (siehe Vorlage Datenblatt) wird
eine gemeinsame Karte erstellt, die als Basis für die Besprechung verschiedener
Typologien in den folgenden Einheiten herangezogen und laufend erweitert wird. Von
Beginn an ist die Einbettung der untersuchten Infrastrukturen in den
spezifischen Kontext der jeweiligen Großsiedlung mitzudenken.
UE2 / BESUCHEN (Gruppenarbeit)
Auswahl und Besuch von drei Orten aus UE1.
Dokumentation spezifischer Eigenschaften und Atmosphären mittels Fotos,
Skizzen, Film- und Tonaufnahmen etc. bis 17. November.
UE3 / BESPRECHEN (Gruppenarbeit)
Ausgehend von den Eindrücken aus der Feldforschung
wird pro Gruppe ein Ort für die vertiefende Analyse ausgewählt. In dieser Phase können
Interviews (Expert*inneninterviews, Go-Along-Interviews etc.) eingesetzt werden.
Dazu wird eine Großsiedlung/Parkplatzinfrastruktur entlang selbst
formulierter Fragestellungen im Detail analysiert. Ergänzend dazu geben Archiv-
und Bibliotheksbesuche Einblicke in die Entwicklung des jeweiligen Ortes.
UE4 / VERWANDELN (Gruppenarbeit)
Auf Basis des gesammelten Wissens werden bis zur Zwischenpräsentation erste Ideen
zur Verwandlung von Einzelobjekten und wiederkehrenden Typologien oder
siedlungsübergreifende Strategien mittels Skizzen und Graphiken formuliert.
UE5 / TEXTEN UND VERFEINERN
(Gruppenarbeit)
Die Recherche fließt in einen Seminartext, die
Entwurfsideen in ein daraus abgeleitetes Projekt ein.
Details zu den genauen Modalitäten werden in den
Workshops bekanntgegeben.
Abgabe
Seminartext und darauf
aufbauender Entwurf; Gemeinsame Karte
- Dozent/in: SchlöglRuth
- Dozent/in: VejnikLukas
- Dozent/in: Fb4Servicezimmer
- Dozent/in: SchmauchUlrike

- Dozent/in: MantaiDavid
- Dozent/in: SchmidtAxel