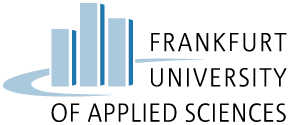- Dozent/in: Lena Inowlocki
- Dozent/in: Irini Siouti
campUAS
Resultados de la búsqueda: 6716
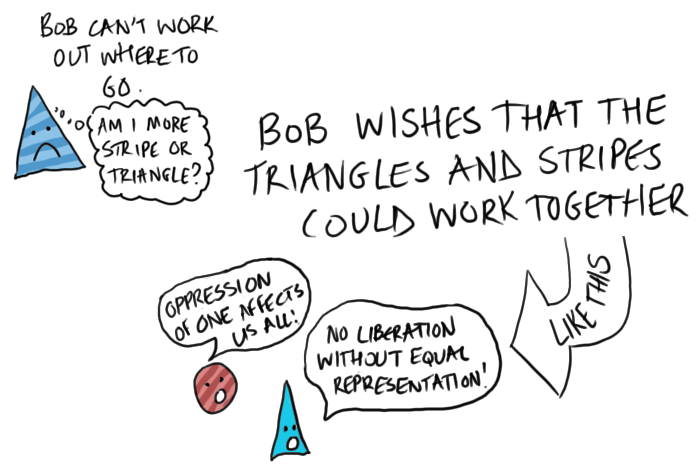
Das Seminar vermittelt theoretische und methodische Grundlagen zur Analyse von sozialen Ungleichheiten und Diskriminierungen bei der institutionellen Organisation von sozialen Leistungen und Hilfen. Die Grundzüge etablierter Verfahren, wie zB Qualitätsmanagement, Gender Mainstreaming, Diversity oder DisabilityManagement oder der Index für Inklusion werden dabei vermittelt. Die Grundlagenvermittlung erfolgt entweder modellhaft für eine ausgewählte Dimension (z.B. Geschlecht, Ethnie, Alter, Behinderungen, sexuelle Orientierung, Religion) oder aber als umfassendes Social Justice-Konzept. Untersuchungsebenen sind: Organisationsstrukturen, Personal, und Zielgruppen der Institution.
- Dozent/in: Sajia Behgam Amin
- Dozent/in: Andrea Jung
- Dozent/in: Beatrix Schwarzer
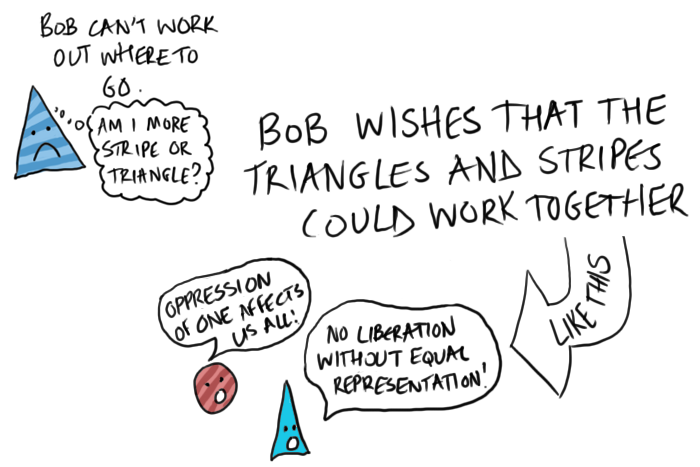
Das Seminar vermittelt theoretische und methodische Grundlagen zur Analyse von sozialen Ungleichheiten und Diskriminierungen bei der institutionellen Organisation von sozialen Leistungen und Hilfen. Die Grundzüge etablierter Verfahren, wie zB Qualitätsmanagement, Gender Mainstreaming, Diversity oder DisabilityManagement oder der Index für Inklusion werden dabei vermittelt. Die Grundlagenvermittlung erfolgt entweder modellhaft für eine ausgewählte Dimension (z.B. Geschlecht, Ethnie, Alter, Behinderungen, sexuelle Orientierung, Religion) oder aber als umfassendes Social Justice-Konzept. Untersuchungsebenen sind: Organisationsstrukturen, Personal, und Zielgruppen der Institution.
- Dozent/in: Sajia Behgam Amin
- Dozent/in: Beatrix Schwarzer
- Dozent/in: Julia Bernstein
- Dozent/in: Servicezimmer Fb4
- Dozent/in: Bettina Bretländer
- Dozent/in: Marcel König
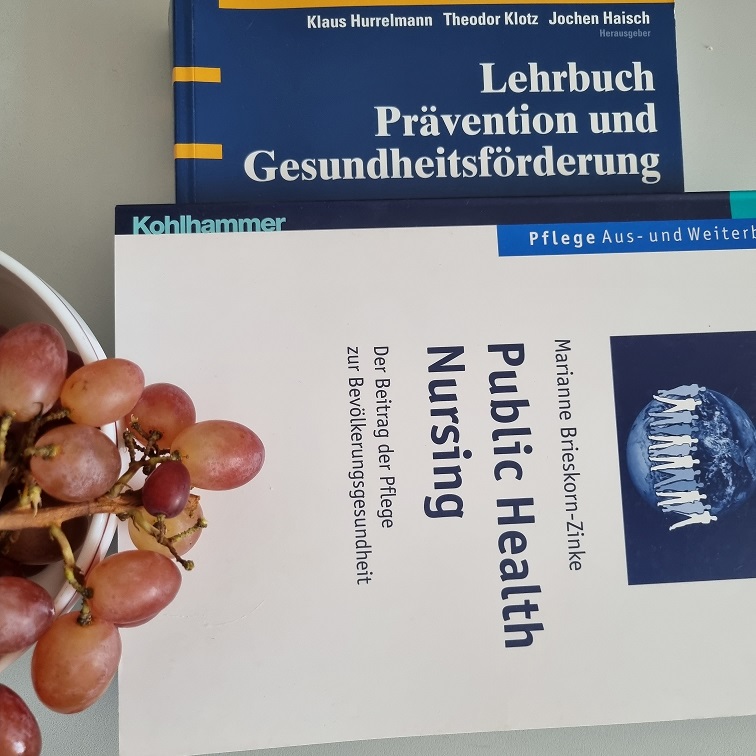
- Dozent/in: Julia Ruth Lademann
- Dozent/in: Servicezimmer Fb4
- Dozent/in: Hans-Joachim Prassel
- Dozent/in: Thorsten Stoy
Dieser Kurs enthält Informationen zum Modul Hospitation (M 16) im MSc APN .
- Dozent/in: Julia Ruth Lademann
- Dozent/in: Ulrike Schulze
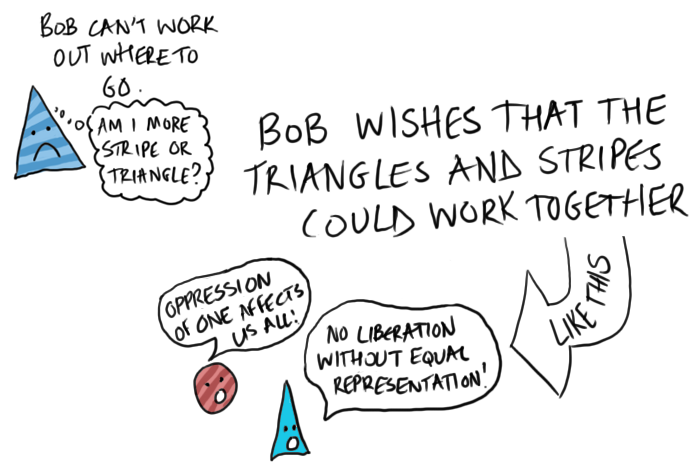
Das Seminar vermittelt theoretische und methodische Grundlagen zur Analyse von sozialen Ungleichheiten und Diskriminierungen bei der institutionellen Organisation von sozialen Leistungen und Hilfen. Die Grundzüge etablierter Verfahren, wie zB Qualitätsmanagement, Gender Mainstreaming, Diversity oder DisabilityManagement oder der Index für Inklusion werden dabei vermittelt. Die Grundlagenvermittlung erfolgt entweder modellhaft für eine ausgewählte Dimension (z.B. Geschlecht, Ethnie, Alter, Behinderungen, sexuelle Orientierung, Religion) oder aber als umfassendes Social Justice-Konzept. Untersuchungsebenen sind: Organisationsstrukturen, Personal, und Zielgruppen der Institution.
- Dozent/in: Clara Schwarz
- Dozent/in: Beatrix Schwarzer
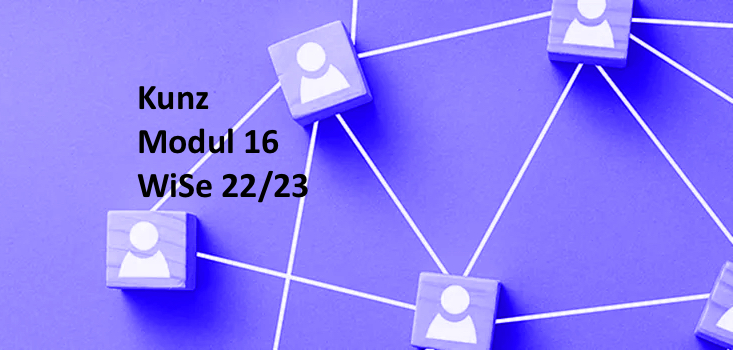
- Dozent/in: Thomas Kunz