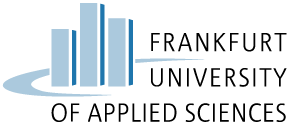- Dozent/in: Helen Schneider
campUAS
Suchergebnisse: 6673
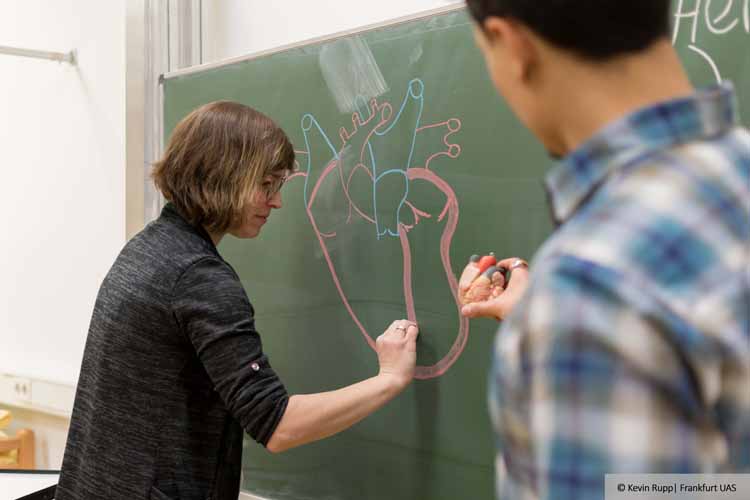
- Dozent/in: Stefan Timmermanns
- Dozent/in: Robin Iltzsche

- Dozent/in: Christoph Schwarz

Neue Medien & Medienpädagogik
- Dozent/in: Caroline Creutzburg
- Dozent/in: Alia Pagin
Neue Medien ‐ Medienkompetenz im digitalen Zeitalter
In diesem Seminar werden medienpädagogische und mediensoziologische Konzepte und Überlegungen innerhalb verschiedener Handlungsfelder in der Sozialen Arbeit vorgestellt und diskutiert. Neben der Vermittlung von Medienkompetenz schließt die medienpädagogische Arbeit auch immer die politische und kulturelle Bildung mit ein - dabei kann die Auseinandersetzung mit medialen Narrativen und Phänomenen nicht nur auf digitale Diskurse reduziert werden, klassische Massenmedien spielen auch in einem digitalen Zeitalter immer noch (oder vielleicht sogar wieder) eine signifikante Rolle. Und mediale Erzählungen erreichen alle Altersgruppen einer Zivilgesellschaft.
Literaturangaben:
"Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl", Katharina Zweig, Heyne 2019
"Unsichtbare Frauen: Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert", Caroline Criado Perez, btb Verlag 2020
The Cleaners, Ein Dokumentarfilm von Hans Block und Moritz Riesewick, kostenfrei zu streamen bei der Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/mediathek/273199/the-cleaners
"Schule und Antisemitismus, Politische Bestandsaufnahme und pädagogische Handlungsmöglichkeiten", Samuel Salzborn (Hrsg.)
"Angriff der Algorithmen, Wie sie Wahlen manipulieren, Berufschancen zerstören und unsere Gesundheit gefährden", Cathy O’Neil, Hanser, 2017
"Radikalisierungsmaschinen: Wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren", Julia Ebner, Suhrkamp 2021
"Fake News, Framing, Fact-Checking: Nachrichten im digitalen Zeitalter", ein Handbuch, Tanja Köhler (Hrsg.), transcript Verlag, 2020
- Dozent/in: Alia Pagin

- Dozent/in: Jana Bielau

- Dozent/in: Sarah Elsuni
- Dozent/in: Support Esther Zeschky
- Dozent/in: Sarah Elsuni
- Dozent/in: Support Esther Zeschky