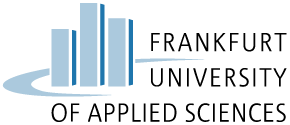- Dozent/in: Georgina Urzowski
campUAS
Suchergebnisse: 6659
- Dozent/in: Georgina Urzowski
- Dozent/in: Ulrich Scheibel
- Dozent/in: Elena Tchernega Meinert
- Dozent/in: Teunis Marius van de Griend
- Dozent/in: Teunis Marius van de Griend

- Dozent/in: Clara Horn
- Dozent/in: Thomas Lehmann
- Dozent/in: Florian Mähl
- Dozent/in: Rick Marsidi
- Dozent/in: Hans Jürgen Schmitz
- Dozent/in: Carolin Seegmüller
- Dozent/in: Tatjana Vautz
- Dozent/in: Kim Yauschew
- Dozent/in: Andreas Zahn

Bachelor Architektur 4. Semester
- Dozent/in: Thomas Lehmann
- Dozent/in: Florian Mähl
- Dozent/in: Hans Jürgen Schmitz
- Dozent/in: Carolin Seegmüller
- Dozent/in: Tatjana Vautz
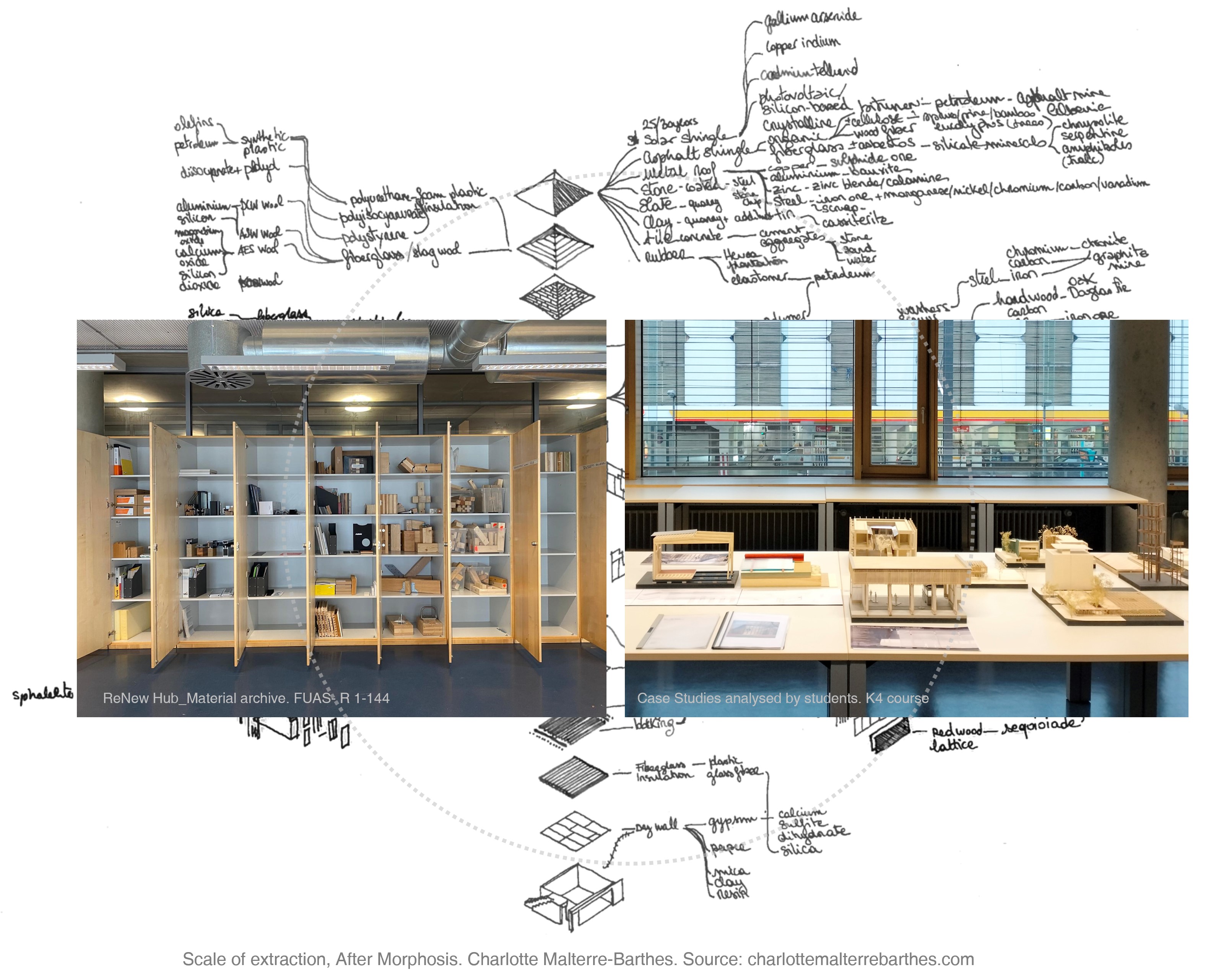
- Dozent/in: Fernando Pérez Blanco
- Dozent/in: Tatjana Vautz

Dear students
Interested in an excursion ?
Tuesday
21.03.23
14:00 - 16:00
Zurich ETH
I have booked a curator's tour for interested students - from all our study programmes.
Udo Thönnissen will be sharing a lot of background knowledge with us.
please register here in the course until next Monday 06.03.23 if you would like to come to Zurich.
The number of places is limited.
Please organise yourself how to get there.
There is the possibility to travel by train from Frankfurt to Zurich in the morning and also the possibility to return to Frankfurt the same day in the evening.
I look forward to welcoming many interested participants and will meet you in Zurich at the Material Hub:
Hönggerberg HIL E Building Library.
To network with other students, possibly from other study programmes,
for example to purchase a group ticket,
please also select the second option:
Liebe Studierende
Interesse an einer Exkursion ?
Dienstag
21.03.23
14:00 - 16:00
Zürich ETH
habe ich eine Kuratorenführung für interessierte Studierende - aus allen unseren Studiengängen - gebucht.
Udo Thönnissen wird uns viel
Hintergrundwissen mitgeben können.
bitte melden Sie sich hier im Kurs bis kommenden Montag 06.03.23 an, falls sie nach Zürich kommen möchten.
Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.
Ihre Anreise organisieren Sie bitte selbst.
Es gibt die Möglichkeit, vormittags mit der Bahn von Frankfurt nach Zürich zu fahren und auch die Möglichkeit, am gleichen Tag Abend nach Frankfurt zurückzukehren.
Ich freue mich über viele Interessierte und treffe Sie in Zürich im Material Hub:
Hönggerberg HIL E Baubibliothek
Um sich mit anderen Studierenden, evt auch aus anderen Studiengängen, zu vernetzen,
beispielweise um eine Gruppenfahrkarte zu erwerben,
wählen Sie bitte zusätzlich die zweite Option aus:
"gerne können Sie meine Kontaktdaten an andere Studierende weitergeben / You are free to pass on my contact details to other students"
den folgenden Text zitiert von der website / the following text quoted from the website:
"Potential Laubholz – Neue Wege im Holzbau
Krummwüchsigkeit, mangelnde Witterungsbeständigkeit und die schwierigen Verklebungseigenschaften von Laubholz haben dazu geführt, dass tragende Bauteile seit dem 19. Jh. hauptsächlich aus Nadelholz bestehen. Heimische Laubholzarten wie Buche, Eiche, Esche und Kastanie werden hingegen vorwiegend im Möbel- und Innenausbau verwendet. Alte Gebäude belegen jedoch, dass Laubhölzer durchaus in tragenden Konstruktionen eingesetzt werden können. Wegen der höheren Festigkeit des Laubholzes sind materialsparende Konstruktionen realisierbar, zudem kann lokales Bauholz eingesetzt werden. Da das Angebot an Laubholz in Mitteleuropa infolge des Klimawandels und einer Neuausrichtung der Waldwirtschaft stetig wächst, wurden die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich während der letzten Jahre ausgedehnt.
Die Ausstellung zeigt verschiedene innovative Laubholzwerkstoffe, die bereits auf dem Markt erhältlich sind, zukunftsweisende Ergebnisse aus der Holzforschung sowie exemplarische architektonische Projekte, in denen Laubholz für tragende Bauteile zum Einsatz kommt.
Potential hardwood - New ways in timber construction
Crooked growth, poor weather resistance and the difficult bonding properties of hardwood are the reasons why load-bearing components have been made mainly of softwood since the 19th century. Native hardwood species such as beech, oak, ash and chestnut, by contrast, are mainly used for furniture and interior furnishings. However, old buildings prove that hardwood can certainly be used in load-bearing constructions, because it has many advantages: due to its greater strength, more slender constructions can be realised, and the boundaries between the load-bearing construction and the interior finish can be rendered more fluid.
As the supply of hardwood resources in Central Europe is steadily increasing as a result of climate change and a reorientation of forest management, research and development work in this area has been expanded over the last few years and hardwood is becoming increasingly important in the construction sector.
The exhibition shows various innovative hardwood materials that are already available on the market, pioneering results from wood research as well as exemplary architectural projects in which hardwood is used instead of softwood. "
Freue mich auf einen erkenntnisreichen Nachmittag Looking forward to an inspiring afternoon
prof. tatjana vautz | entwerfen und baukonstruktion | lehreinheit architektur
- Dozent/in: Florian Mähl
- Dozent/in: Tatjana Vautz